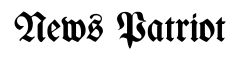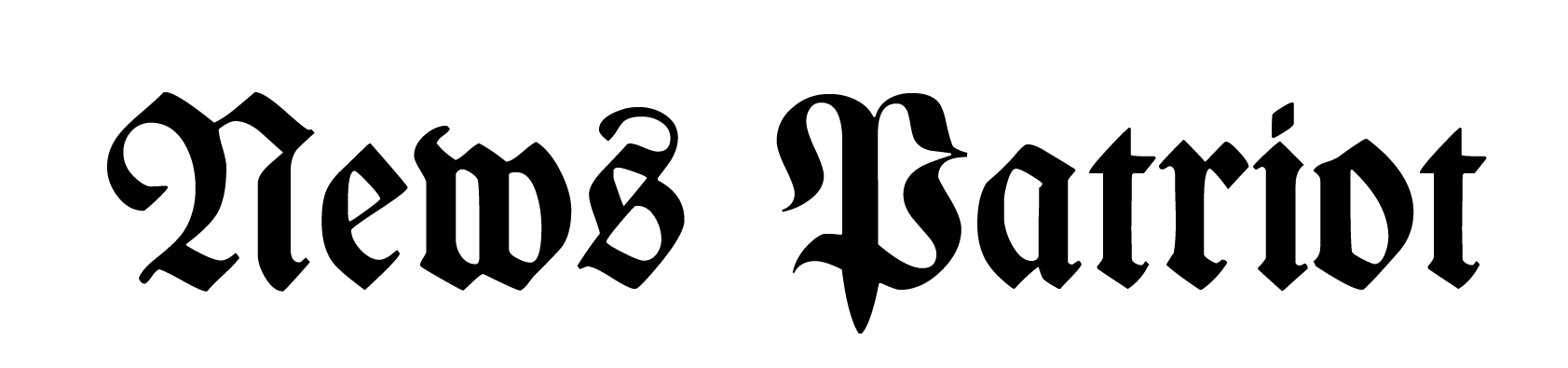Bonn (ots)
Am 24. Juli werden die Spitzen der EU in Peking mit Vertretern der chinesischen Regierung zusammentreffen. Dabei gerät ein Großteil der medialen Aufmerksamkeit auf die wachsenden Spannungen im Handelssektor sowie in der geopolitischen Arena. Ein Thema könnte jedoch erneut in den Hintergrund gedrängt werden: die systematischen Menschenrechtsverletzungen in China. In dem Land werden nach wie vor fundamentale Rechte missachtet, insbesondere jene von Arbeitnehmer*innen und ethnischen Minderheiten.
„Wer Handelsbeziehungen mit China unterhält, darf nicht die Augen verschließen vor Fakten wie Zwangsarbeit, dem Verbot von Gewerkschaften und überlangen Arbeitszeiten. Die EU sollte beim bevorstehenden Gipfel unmissverständliche Erwartungen bezüglich der Menschenrechte formulieren – nicht als ein Nebenaspekt, sondern als zentrale Kondition für die wirtschaftliche Zusammenarbeit“, so Dr. Sabine Ferenschild vom Bonner SÜDWIND-Institut.
Die menschenrechtliche Lage in China bereitet seit Jahren Sorgen:
- Zwangsarbeit in der Uigurischen Autonomen Region wird nach wie vor dokumentiert,
- Gewerkschaftsfreiheit existiert de facto nicht,
- Arbeitsrechte werden in zahlreichen Sektoren systematisch verletzt.
Diese Missstände betreffen auch europäische Lieferketten: Viele Produkte, die in Europa erworben und genutzt werden, sind mit genau diesen Risiken behaftet. Trotz dieser alarmierenden Tatsachen ist nicht zu erwarten, dass die EU-Führung das Thema beim Gipfel aktiv ansprechen wird.
„Menschenrechte sind kein diplomatischer Luxus – sie sollten das Fundament jeder internationalen Beziehung bilden. Wer faire Handelspraktiken fordert, muss zuerst die Menschen respektieren, die in den Produktionsprozessen tätig sind“, erklärt SÜDWIND-Expertin Sabine Ferenschild.
Presseinfo: Menschenrechtliche Risiken in der Solarindustrie
Hintergrund
Solarmodule sind entscheidend für den Übergang zu erneuerbaren Energien, stellen jedoch erhebliche menschenrechtliche Risiken dar – insbesondere beim Abbau von Rohstoffen und der Herstellung von Polysilizium in der Region Xinjiang in China. Berichte der Vereinten Nationen belegen Zwangsarbeit von Uigur*innen und anderen Minderheiten. Über 80 Prozent der weltweit verwendeten Solarmodule stammen aus China, während etwa 40 Prozent des globalen Polysiliziums aus Xinjiang kommen.
Lieferkettenproblematik
Viele Solarunternehmen sind über Zwischenhändler involviert und haben nur begrenzte Kontrolle über die vorgelagerten Produktionsschritte, in denen die schwerwiegendsten Menschenrechtsverletzungen auftreten.
EU-Gesetzesinitiativen
Die geplante EU-Verordnung gegen Zwangsarbeit betrifft unter anderem die Solarbranche: Der Import von Solarmodulen und Komponenten, die unter Zwangsarbeit produziert wurden – wie zum Beispiel Polysilizium aus Xinjiang – könnte betroffen sein. Zusätzlich sieht das geplante EU-Lieferkettengesetz vor, dass Unternehmen ihre gesamte Lieferkette – vom Rohstoffabbau bis zur Endverarbeitung – systematisch auf Menschenrechtsverletzungen, Umweltverstöße und unfaire Arbeitsbedingungen untersuchen müssen. In der globalisierten Solarindustrie mit oft komplexen und intransparenten Lieferstrukturen wäre dies ein entscheidender Schritt zu mehr Transparenz und Verantwortungsbewusstsein.
Abschwächung des Lieferkettengesetzes
Das Lieferkettengesetz wird jedoch voraussichtlich stark abgeschwächt: Viele deutsche Solarunternehmen könnten aufgrund hoher Umsatzgrenzen von der Verantwortung ausgeschlossen werden. Dadurch würden schwerwiegende Risiken überwiegend unkontrolliert bleiben.
Ausblick
Im Herbst 2025 wird das EU-Parlament über die Gesetzesinitiativen verhandeln, mit einer geplanten Abstimmung im Oktober 2025.
Pressekontakt:
Dr. Sabine Ferenschild
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
E-Mail: ferenschild@suedwind-institut.de